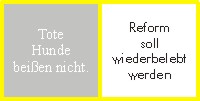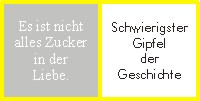Gesamtprojekt
Das A9 Projekt kreist
um Kommunikation und die mit ihr einhergehenden Vereinfachungen. Aus dieser
Notwendigkeit erwachsen Möglichkeiten und Schwierigkeiten. Als bezeichnende
Resultate dieses Prozesses werden klassische Sprichwörter und aktuellen
Schlagzeilen einander gegenübergestellt. Alltagssprache in historischer
und aktueller Sicht wird exemplarisch befragt.

Diese Sprüche werden als Texttafeln,
auf Objekten, in Kombination mit Bildern und anderen Formen eingesetzt.
Ob Kunstobjekte in einer Innenstadt hängen
und dort Werbetafeln zum verwechseln ähnlich sehen, ob sie sich ganz
privat in einer Wohnung befinden, ob in einer Galerie oder an der Autobahn:
stets sind die Bedingungen andere, und die Zusammenhänge, die sich
beim Betrachten herstellen. Stets geben die Sprüche andere Aspekte
frei.
Durch die verschiedenen Plazierungen werden
die Fragen nach ‘Gemeinplätzen’ und ‘Konsensfindung’ die in den Sprüchen
stecken, auf die Orte ausgedehnt. Was tut ‘Kunst im öffentliche
Raum’?
Welche Lesarten werden durch die Umgebung
hervorgebracht?
Das A9 Projekt setzt sich so aus einer
Zahl von Teilprojekten zusammen, die wie Mosaiksteine gemeinsam ein Bild
ergeben.
Die räumlich umfangreichsten Teile,
der auch namensgebend für das Gesamtprojekt sind, arbeiten mit den
Bedingungen, die an einer Autobahn herrschen.
Sprichwörter und Schlagzeilen
Schlagzeilen und Sprichwörter sind
Sprachbilder, sprachliche Gemeinplätze. Sie sind verbale Schilder,
und in ihrer Herkunft und Auswirkung komplexe Sprachzeichen.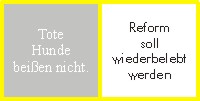
Sie bezeichnen soetwas wie eine Gegenwarts-
und eine Vergangenheitsachse in der Sprache. Wie sieht sich die Gesellschaft,
wie beschreibt sie sich, und wie bringt sie das ‘auf einen Nenner’? Was
wird dabei ausgeschlossen und was hervorgehoben?
Und: wer spricht hier überhaupt ?
Schlagzeilen und Sprichwörter haben
einiges gemeinsam:
Sie sind plakative Verkürzungen,
die uns umgeben und beeinflussen. Ein weinendes und ein lachendes Auge:
Sie vergröbern und deformieren, können aber mit ihrer einfachen,
direkten Art Gespräche erleichtern.
Schlagzeilen sind vergänglich, Aktualität
ist ihr Charakter.
Plakativ und lautstark skizzieren sie
die ‘Wichtigkeiten’ des Tages. Sie sind das Angebot, das uns weiterlesen
läßt oder nicht, sie werten und ‘richten’ mit drei Worten -
sind das, was sich einprägt.
Schlagzeilen markieren einen Moment, ein
Ereignis im Zeitgeschehen. Mit dem Ereignis ihrer Herkunft gemeinsam treiben
sie in die Vergangenheit. Je älter sie werden und je schwächer
ihre Verankerung im aktuellen Geschehen wird, um so prägnanter tritt
ihre Struktur zutage.
Nichts sagt mehr über unsere Befindlichkeit
in gesellschaftlicher Gegenwart als die Schlagzeile von gestern.
Sprichwörter hat keiner erfunden:
Ihre Herausschmelzung über lange Zeit
gehört zu den Prozessen, die mit dem Zusammenleben der Menschen einhergehen.
Nutzung, Entstehung und Präsenz dieser volkstümelnden Weisheiten
sind vielschichtig. Ihre einseitigen und fragwürdigen Verallgemeinerungen
bergen andererseits eine enorme Authentizität. Soziale Felder und
Zeit sind in ihnen gespeichert, wie Wurzeln reichen sie in die Tiefe der
Vergangenheit.
In ihrer Formelhaftigkeit sind sie verfügbare
Sprachmuster, die sichauf einen gemeinsame historischen Sozialität
beziehen. Sie legitimieren sich über ihr Alter und ihre Konsensfähigkeit.
Abseits der Frage wie stark die ‘orginalen’
Sprichworte tatsächlich noch benutzt werden, stehen sie für die
komplette Palette von Grundformeln, die im sozialen Getriebe strukturierend
wirken.
Bei der Auswahl der
Sprichwörter wird auf die Sammlung von Karl Simrock zurückgegriffen,
die 1846 erstmals erschien und 12.396 Sprichwörter enthält.
Die Kombination von Sprichwörtern
und Schlagzeilen
Das Finden der Kombinationen ist ein langwieriges
und vorsichtiges Abwägen. Mit Hilfe von Suchoptionen in Dateien und
einer Flut von Zetteln , die wie Dominosteine aneinandergehalten werden,
wird gearbeitet. Da stehen vor den ‘Inhalten’ die Sprachformen: Lautstärke
der Formulierung, Textgeschwindigeit, Gewichtung etc. Da wird behauptet,
argumentiert, bewiesen. Irgendwann schälen sich in der Arbeit des
‘kombinierens’ dann die idealen Partner heraus, die sich ergänzen
und provozieren, laut oder leise ständig Energie hin- und herschieben.
Sie arbeiten und rumoren weiter - unter der Oberfläche, die sie uns
zunächst so eilfertig und einfach anbieten.
Aus Texten und Reden zum Projekt
Eröffnung der Ausstellung in Potsdam,
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Ulf Erdmann Ziegler
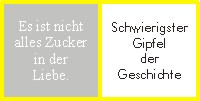
(...)
Henrik Schrats A 9-Projekt ist eine ungewöhnliche
Idee, aber es ist auf die Fundamente der Kunstgeschichte gebaut.
Bevor es das Wort „Landschaft“ überhaupt
gab, war „das da draußen“ die Natur, oder religiös gesprochen,
das Paradies. Die Ausdeutung des natürlichen Raums durch Fürsten
und ihre Krieger hat der Kunsthistoriker Martin Warnke beschrieben und
das Ergebnis als „politische Landschaft“ bezeichnet. Dazu gehört jedes
lesbare Zeichen, vom Hinweisschild nach Jerusalem bis zum Arminiusdenkmal
im Teutoburger Wald.
Die „Politische Landschaft“ hat aber am
Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts Konkurrenz bekommen und ist gleichermaßen
eine „Kommerzielle Landschaft“ geworden.
(...)
Anders als Werbeleute, die Widersprüche
benutzen, um Aufmerksamkeit herzustellen, konzentrieren sich Künstler
auf ein Rätsel, das im Verhältnis der Sprache zu ihrer Form liegt.
Aus der Sicht der bildenden Kunst gibt es eine leibhaftige Verbindung zwischen
Sprechen und dem Absurden, einen eingebauten Widerspruch zwischen dem,
was gesagt wird, und dem sinnlichen Ausdruck, in dem das Gesagte in Erscheinung
tritt. Die kommerziellen Muster werden sprachlogisch hintertrieben. Die
bisher bekanntesten Versuche stammen von zwei amerikanischen Künstlerinnen,
die in den achtziger Jahren Furore gemacht haben, Jenny Holzer und Barbara
Kruger. Kruger hat Bilder zitiert und mit Slogans versucht zu zersetzen
(„We don’t need another hero“ / „I shop therefore I am“). Jenny Holzer
hat kurze und längere Monologe verfaßt, die sie als kommerzielle
Schrift - Leuchttafeln und Laufschriften - hinausgebracht hat in die Welt:
„Protect me from what I want“, präsentiert in einer der dichtesten
kommerziellen Landschaft Amerikas, dem Las Vegas Strip - das war schon
ein Coup.
Eine Kunst, die sich in dieser Gestalt
einmischt in den öffentlichen Diskurs, hat natürlich mit sehr
viel mehr Widerständen zu rechnen als ein gemaltes Bild. Denken Sie
daran, daß Christo mehr als zwanzig Jahre gebraucht hat, um endlich
den Reichstag verhüllen zu dürfen; und vorher mußte, was
ja nicht so sehr wahrscheinlich war, die Berliner Mauer „fallen“.
Das gilt allerdings auch für das
A 9-Projekt vom Schrat. Es soll eine Autobahn mit Sprachzeichen bespielen,
die aus der Sicht eines Pendlers zwischen Berlin und München zur Hälfte
eine löchrige Wegstrecke war, gerahmt von zeitraubenden und entnervenden
Grenzen. Aus der Sicht von jemand wie Henrik Schrat selbst, der im thüringischen
Greiz unweit der Autobahn aufgewachsen ist, war die Autobahn ein forcierter
Beleg der Eingeschlossenheit, weil sie für die Westdeutschen „Transit“
war und für die Ostdeutschen das südliche Ende einer Achse, die
definitiv dort endet, wo das Fränkische begann.
Die A9 zu bespielen, beginnend in der
Nähe der Hauptstadt Brandenburgs bis kurz vor die Tore der Hauptstadt
Bayerns, ist eine Idee, die die deutsche Wiedervereinigung voraussetzt.
Darüber hinaus ist es eine Idee, die deutsche Wiedervereinigung feiert,
indem sie ein Band, das ursprünglich einen Knoten hatte, als offenes
und verbindendes Band sichtbar macht.
(...)
Anders als bei Jenny Holzer, sind beim
Schrat die Texte nicht vom Künstler selbst verfaßt; ähnlich
wie bei Barbara Kruger geht es um einen „semiotischen Konflikt“, einen
Konflikt von Zeichensprachen - nur daß es nicht um den Konflikt von
Wort und Bild geht, sondern um den Konflikt zweier zunächst auf Unkenntlichkeit
ihrer Quelllen geschliffener Nachrichten.
(...)
Um das Projekt vom Schrat in Bezug auf
die deutsche Einheit zu deuten, würde ich gern ein anderes Projekt
heranziehen, das zur Zeit in der Ausstellung „Deutschlandbilder“ im Martin
Gropius-Bau in Berlin zu sehen ist. Auf einem Videomonitor werden dort
jeweils zwei Zeitungsschlagzeilen zitiert. Die eine stammt aus dem „Neuen
Deutschland“, die andere aus der „Bildzeitung“. Die Künstler, Renata
Stih und Frieder Schnock, haben einen Zeitraum von dreißig Jahren
zitiert. So heißt die Schlagzeile im ND einen Tag nach dem Bau der
Berliner Mauer: „Maßnahmen zum Schutz des Friedens und zur Sicherung
der Deutschen Demokratischen Republik in Kraft“; am selben Tag „Bild“:
„Berlin kocht vor Wut“.
Schrat’s A9 Projekt ist im Vergleich
weniger dokumentarisch, aber subtiler im Text. Dabei greift Henrik Schrat
nicht auf alte Zeitungen zurück, sondern zitiert Quellen unserer Zeit,
die mit Sicherheit bis zur Aufstellung der Tafeln in vielleicht ein oder
zwei Jahren noch aktualisiert werden. Strenggenommen kommen nur „Westzeitungen“
zu Wort, also Zeitungen, deren freie Meinungsäußerung durch
das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist. Diese
Garantie von Freiheit meint nicht „Objektivität“, sondern den vollen
Radius des Ausdrucks, von der barschen Nachricht, über die manipulierte
Kolportage bis zum abstrusen Geblödel. Dieses Spektrum erkennt man
im A9 Projekt. Die Sprichworte entstammen aber nicht dem Kontext der Medien.
Es würde sie auch dann geben, wenn die freie Meinung alles andere
als garantiert wäre. Genaugenommen betreibt der Volksmund den Flurfunk,
den kein Regime unterdrücken kann. Womit ich nicht behaupten will,
daß Sprichworte im Prinzip widerständig seien. Sie sind es nicht.
Im besten Fall sind sie entlarvend, wie: „Es schlafen nicht alle, die mit
der Nase schnaufen.“
(...)
Meine ganz persönliche Vermutung ist,
daß der Schrat auf das Modell Sprichworte und Schlagzeilen nicht
gekommen wäre, wenn er im Westen großgeworden wäre. Seine
Schlagzeilen stehen für das „westlich“ gewordene Gesamtdeutschland,
seine Sprichworte für einen urdeutschen Sprachschatz, der natürlich
lange vor der NS-Zeit etabliert war, aber im ostdeutschen Staat präzise
konserviert worden ist. Insofern lebt das Projekt, auch wenn es auf der
Vereinigung basiert, von der Erinnerung an das „zerrissene Land“, wie der
Untertitel der „Deutschlandbilder“-Ausstellung nicht ganz korrekt wiedergegeben,
aber doch treffend verfremdet worden ist.
(...)
Ein Projekt, wie das von Schrat wird sicher
viele Gegener haben, einfach weil es auffällt und mit Zeichen umgeht,
die emotional in irgendeiner Form besetzt sind. Das muß auch so sein,
sonst wäre es belanglos. Henrik Schrat und Peter Hochel, der für
die Organisation verantwortlich ist, haben ferner ein Raststätten-Informationssystem
erarbeitet, das zweierlei leisten kann: den Reisenden Aufschluß über
die Quellen zu geben und die Schrifttafeln in Form von sympathischen Merchandize
unter die Leute bringen. So soll das Projekt auch finanziert werden.
Ich denke, wir sollten helfen, es auf
den Weg zu bringen.
15. September 1997
Peter Herbstreuth
ACC Galerie, Weimar, 3. April 1998;
Wer das Werk losgelöst von seiner
Umgebung betrachtet und den Ort übergeht, an dem es sich ereignet,
beschränkt sich auf Teilfragen, die das Ganze nicht in den Blick
bekommen. Man wird also von Henrik Schrats A 9 Projekt nicht sprechen können,
ohne auf den Ort und die Stelle einzugehen, an dem es gezeigt wird. Schrat
bearbeitet, wie er sagt, den kulturellen Kontext, hat sich lange über
Fragen des Zusammenhangs Gedanken gemacht und steht damit in einer Traditionslinie,
die ich kurz skizzieren möchte.
Denn selten wird der künstlerische
Einsatz nachhaltiger zum Politikum als wenn er seine angestammten Räume
verläßt und sich öffentlich vor aller Augen und für
alle Zeit wie eine architektonische Tatsache aussetzt. Solange die Tat
eines Künstlers hinter Museumsmauern verborgen und den alltäglichen
Blicken entzogenen ist, genießt sie den Schutz und die Ehre in einem
der letzten Freiräume der Gesellschaft.
(...)
Wenn Kunst diesen Raum verläßt
und Teil des Stadtraums und des alltäglichen Blicks werden will, gelten
plötzlich andere Gesetze. In Galerien, Kunsthallen und Museen bedarf
es der Zustimmung weniger. Und diese Wenigen sind meistens Spezialisten
und haben sich letztendlich um nichts anderes zu kümmern als um die
Gesetze und Traditionen der Kunst selber, die manchmal im Kontrast zu den
Gesetzen außerhalb der Kunsträume stehen. Aber das ist nicht
das Problem der Wenigen. Im Stadtraum jedoch bedarf es der Zustimmung vieler.
Und diese Vielen sind selten Spezialisten und neigen dazu, die Kunst nach
Fragen des Geschmacks, der Schicklichkeit und des Gebrauchswerts zu beurteilen.
Man fragt, ob es einem gefällt, ob es sozial verträglich ist,
ob es nützt. Der Stadtraum ist der Raum der Demokratie und erlaubt
nur in Ausnahmefällen exorbitante Leistungen oder - wenn man so will
- ortsfremde Behauptung von Einzelnen, die nicht auf alles Rücksicht
genommen haben.
Früher - in den sechziger Jahren als
mit Michael Asher, Daniel Buren, Hans Haacke und anderen jungen Künstlern
in Westeuropa und Nordamerika eine ins öffentliche Bewußtsein
drängende und teilweise eminent politische Kunst entstand, die nicht
nach dem ortsüblichen Konsens fragte - tauchte der Begriff "Ortsbezogenheit"
oder site-specifity erstmals auf. Man verstand darunter eine Verweigerungshaltung
gegenüber dem Warencharakter und gegenüber der Mobilität
von Kunst. Diese Künstler hatten begriffen, daß Kunst erst dann
über die Spezialisten hinaus wirken kann, wenn sie ihren vorgesehenen
Freiraum verläßt und das Publikum dort abholt, wo es damals
stand: vor den Schwellen des Museums auf der Straße, in den Parks,
auf Plätzen. Diese ortsbezogene Kunst wurde nicht für den neutralen
Raum in einer Galerie oder einer Kunsthalle geschaffen, sondern suchte
sich eine bestimmte Situation an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten
Zeit und war zunächst in ihren Materialien weder für eine lange
Dauer gemacht noch in ihrer Tragweite für die Ewigkeit gedacht. Sie
tauchte auf, um nachhaltig Eindruck zu hinterlassen und wieder zu verschwinden.
Ihr Sinn lag nicht darin, unveränderlich zu dauern, sondern zu intervenieren.
Kunst - im Sinne einer entschieden freigesetzten visuellen Erscheinung
- war ein Mittel in die Wahrnehmungswelt Stadtraum einzugreifen und dieser
Eingriff geschah mit kritisch gemeinen Absichten, denn der Eingriff wollte
das Gewohnte verstören oder parodieren oder zumindest etwas in die
Wahrnehmungswelt setzen, von dem nicht auf Anhieb gesagt werden konnte,
was es denn nun ist und was es denn bedeuten mag - eine Kunst also, die
sich gar nicht als Kunst vorstellte, sondern als zunächst Undefinierbares.
Es konnte weder der Produktwerbung, noch der politischen Propaganda zugeschlagen
werden, und es hatte auch keinen Gebrauchswert. Es waren oft kleine, intelligente,
witzige Ideen, die ein wenig Verwirrung stifteten und bisweilen nach Guerilla-Taktik
organisiert waren. Sie tauchten plötzlich und unvermittelt auf und
man wußte oft nicht, wer der Täter war. Es war ein visuelles
Ereignis, das einem zustieß wie eine zufällige, aber bemerkenswerte
Begegnung, die zum Gespräch Anlaß gab, manchmal auch ein unverhoffter
Angriff auf die Sinne.
(...)
Was damals noch unmöglich schien,
gehört heute zum Alltag und wird von vielen Kunstvereinen als eine
Möglichkeit unter anderen selbstverständlich in Stadtraum-Aktionen
in Betracht gezogen. Und mittlerweile geht es auch nicht mehr um die verblüffende
Abweichung von der Norm als solcher, sondern um deren Qualität.
(...)
Kunst bleibt nur Kunst, wenn sie die selbstgesetzten
Vorgaben reflektiert überschreitet und die hohen Erwartungen, die
an sie herangetragen werden, mit einem leichten Dreh erneut ins Staunen
versetzt. Denn das Besondere, was Kunst im Raum der Demokratie zu leisten
vermag, besteht darin, daß sie durch die Diskussion über ein
zentralisierendes Problem die Gesellschaft zum Sprechen bringt. Und von
Gesellschaft kann nur dann gesprochen werden, wenn sich Viele wiederholt
über ein und dieselbe Sache aus verschiedenen Blickwinkeln verständigen.
Womit deutlich ist, daß diese interventionistische,
diese in die Belange des Öffentlichen eingreifende Kunst zeitliche
Grenzen hat. Nicht alle Kunst will Ewigkeit.
(...)
All dies muß man im Auge behalten,
wenn nun von Henrik Schrats A9 Projekt die Rede ist. (...) Er hat mit untrüglichem
Gespür das Wissen des Allgemeinen an denjenigen Ort getragen, der
nur befahren wird, um wieder verlassen zu werden. Transit-Strecke trägt
im Deutschen noch immer den Nachklang der Zeit vor 1989. Aber das, so scheint
mir, ist ein eher beiläufiger, wenngleich bereichernder Aspekt dieses
Vorhabens. Transit-Räume sind die anonymen und transnationalen Räume
par excellence. Tankstellen, Flughäfen, Einkaufszentren, Autobahnen
sind weitgehend geschichtslos. Denn niemand bleibt dort, niemand belebt
sie, niemand beginnt dort eine Geschichte. Und gerade auf der Autobahn,
im Niemandsland, wo selbst historische Orte längs der Fahrstrecke
als solche bezeichnet werden und damit den Charakter einer Sehenswürdigkeit
und eines Schauspiels gewinnen, als ein inszeniertes Gebilde, das gleichsam
zur Kunst im öffentlichen Raum wird, hier ist der Ort, an dem das
ganz Alte, fast schon Vergessene mit dem Schnellebigen am Besten zusammenzünden
kann. Man fährt an den Tafeln entlang - wie man - cum grano
salis - an den linear in einer Reihe gehängten Bildern in Museen entlang
ginge, wo die Alten Meister mit Plakaten von gestern und vorgestern zünden
sollen. Manche zünden, manche nicht. Das hängt auch von denjenigen
ab, die schauen.
Und wenn wir dann die Zeilen lesen
>Auf den Rädern durch die Ausstellung
>Zum Raum wird hier die Zeit
>Schrat klopft Sprüche und der Schein
trügt
>Zumutung oder Anregung ?
dann wissen wir, seine Arbeit ist selbst
Schlagzeile geworden und hat sie integriert.
Denn Das A9 Projekt ist ein Modul. Es ließe
sich von der Sache her auch in Frankreich oder in Norwegen durchführen.
Denn die Arbeit trägt eine Utopie: das Alte mit dem Neuen zünden.
Deshalb wird der Transit-Raum für zwei Monate zu einer Metapher, in
der innerhalb der Sprachkultur sich Tradition und Geschichtsvergessenheit
vermitteln sollen.
Wenn es klappt, dann ist die Moderne noch
nicht zuende.
Peter Herbstreuth