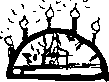Schluss mit Ritze Ratze
Henrik Schrat erweitert den Kunstbegriff
und zeigt Lasergefertigtes aus dem Erzgebirge
Stefan Heidenreich
Es war einmal ein Erzgebirge,
da gab es Holz. An langen Winterabende schnitzten Bauern und Arbeiter
Muster und Figuren aus Holz. Touristen kamen und kauften die Holzschnitzereien
aus dem Erzgebirge. Und wenn die Holzschnitzer nicht gestorben sind ...
Heute kommt die typische Erzgebirgs-Schnitzarbeit nicht aus Sachsen, sondern
aus China. Wer in Aue, Hohenstein-Ernstthal oder Seiffen noch schnitzt,
kann mit den Lohnstückkosten in fernen Osten längst nicht mehr
konkurrieren. Die Produktion geht den Gang aller Handarbeit: sie wird
ausgelagert.
Das Stilmuster Erzgebirge ist globalisiert. Die Mobilität der Dinge
betrifft nicht nur materielle Produkte, sondern genauso immaterielle.
Als Datensatz wird exportiert, was dann mit dem Aufdruck "handgefertigt"
in die Touristenshops zurückkommt.
Was der Künstler Schrat - er stammt aus Sachsen und hat in Dresden
die Akademie besucht - mit der Erzgebirgsromantik macht, stellt das konsequente
Gegenstück zum Export der Arbeitsplätze dar. Der Auslagerung
der Produktion in Billiglohnländer steht die Verlagerung der einheimischen
Kompetenz auf den Entwurf gegenüber. Aber die Erzgebirgs-Holzschnitzerei
ist kein Turnschuh, sondern ein traditionelles Muster und bietet deshalb
für Variationen keinen Spielraum. Die Verhältnisse von traditonellem
Original und digitaler Simulation führen zur einer scheinbar verkehrten
Welt. Die Handarbeit beharrt auf der Wiederholung von Formen und ihre
Authentizität erschöpft sich im Stumpfsinn vor-technischer Serienmanufaktur.
Schrats Erzgebirgs-Holzschnitzerei werden von Händen nicht angerührt.
Laserstrahlen fräsen die ziselierten Formen aus Sperrholz. Anders
wäre es nicht möglich, feinste Linienzüge wie etwa das
Gitter eines Einkaufswagens aus dem Holz herauszupräparieren. Der
Charakter des Materials verwandelt sich. Mit schwarzer Lackierung versehen
wird das handelsübliche Sperrholz vollends zu einem willkürlich
formbaren Kunststoff. Dennoch behält die Hand des Künstlers
eine Aufgabe, und zwar dort wo ein Designprogramm wie Freehand sie ihr
zuweist. Im Computer versieht Schrat die Traditionsmuster mit digitalen
Variationen. Eine große Schneeflocke entsteht aus den traditionellen
Symmetrien des Sechsecks, aber dann variiert der Künstler jeden einzelnen
Zacken des Schneekristalls und erzeugt so ein Objekt, das von Ferne die
Ästhetik des Nippes-Ornaments aufruft, bei genauerem Hinsehen aber
zu einem Spiel von Abweichungen wird. Es zeigt sich, daß nicht etwa
die Produktionsform von Hand eine Nähe zur Natur hervorbringt, sondern
daß der Variantenreichtum sich viel eher digital entwerfen und automatisch
herstellen läßt. So gelingt es dem Künstler, mit den "Grüßen
aus dem Erzgebirge" die Widersprüche zwischen romantischer Ideologie
und digitaler Kultur herauszustellen. Regionale Muster werden digital
simuliert, während traditionelle Produktionsweisen globalisierte
Fakes sind. Romantische Naturverbundenheit entsteht durch Mausklick und
Laserstrahl, während Handarbeit vorgebliche Authentizität als
serielles Massenprodukt erzeugt.
Der Künstler Henrik Schrat hat sich genügend mit den Beziehungen
zwischen Kunst und Wirtschaft beschäftigt, um die ökonomische
Dimension seiner Arbeit reflektieren zu können. Im letzten Jahr installierte
er im Saal der Frankfurter Börse ein großes Tableau aus Bonbonpapieren
als buntes Abbild des Güterverkehrs. Zur Zeit arbeitet er an der
Slade School in London an einem Projekt, das anstelle des Künstlers
einen Manager-in-Resident an die Hochschule holen wird.
Die ökonomische Perspektive steht bei den "Grüßen
aus dem Erzgebirge" nicht im Vordergrund. In manchen Laserschnitten
bricht die Warenwelt motivisch ein, etwa in Form eines Einkaufswagens.
Aber ansonsten gebraucht Schrat das Erzgebirgs-Muster zumeist als Stilvorlage,
die variiert und ergänzt wird. Manche Arbeiten geben sich dem Dekorativen
hin und lösen sich ganz im Ornament auf, andere beziehen auf das
Erzgebirge als romantische Szenerie, etwa die Arbeit "Pisser (Freunde
machen)", in der drei junge Männer an einen Baum urinieren.
Seit Duchamps Urinal ist das Urinieren festes Motiv im Formenschatz der
modernen Kunst. Der feine Wasserstrahl, durch den die neuen Freunde das
romantische Baummotiv verwandeln, hätte sich ohne die Hilfe des Lasers
nicht aus dem Sperrholz schneiden lassen.
Henrik Schrat: Grüße
aus dem Erzgebirge
Galerie Olaf Stüber, Max-Beer-Str. 25, 10119 Berlin-Mitte, noch bis
31.12.2001, Di-Sa 14-18 Uhr
Die Ausstellung
Bilder